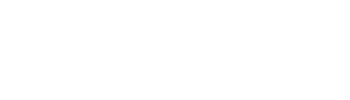Was ist Botrytis cinera / Grauschimmel
Botrytis cinerea, im Deutschen besser bekannt als Grauschimmel, ist ein weit verbreiteter Pilzerreger, der im Gartenbau und Zierpflanzenanbau erhebliche wirtschaftliche Schäden verursacht. Die Folge sind verminderte Blütenqualität und eine kürzere Haltbarkeit nach der Ernte (Williamson et al., 2007).
Die gezielte Erhebung und Analyse von Klimadaten ist ein entscheidender Baustein integrierter Pflanzenschutzstrategien (IPM), um Grauschimmel-Ausbrüche von vornherein zu verhindern. Indem Anbauer optimale Wachstumsbedingungen aufrechterhalten, können sie die Pilzentwicklung unterdrücken und gleichzeitig den Einsatz chemischer Mittel minimieren (Elad et al., 2016).
Dieser Bericht zeigt, wie ein präzises Klimamonitoring – mit Fokus auf Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Luftzirkulation und Blattnässe – die Grauschimmel-Befallsrate im Zierpflanzenbau signifikant reduzieren kann.

Botrytis cinerea: Günstige Umweltbedingungen und Krankheitszyklus
Botrytis ist an kühle (15–25 °C) und feuchte (>85 % relative Luftfeuchtigkeit) Umgebungen angepasst, wobei die Sporen bei anhaltender Blattnässe schnell keimen (Jarvis, 1977). Der Pilz verbreitet sich über Konidien in der Luft, die Blüten, Stängel und Blätter befallen, insbesondere in dichten Baumkronen mit schlechter Belüftung (Dean et al., 2012). Zu den wichtigsten Umweltfaktoren gehören:
- Hohe relative Luftfeuchtigkeit (RH): Eine anhaltende Luftfeuchtigkeit von über 85 % begünstigt die Keimung der Sporen (Holz et al., 2007).
- Kondensation und Blattnässe: Freie Feuchtigkeit über einen Zeitraum von 6–12 Stunden ermöglicht eine Infektion (Dik & Wubben, 2004).#
- Luftströmung: Unbelüftete Luft (stagnierende Luft) erhöht die Sporenretention und die Ausbreitung der Krankheit (Nicot et al., 2016).
- Temperaturschwankungen: Kühle Nächte gefolgt von warmen Tagen begünstigen die Kondensation (Fernández & Tello, 2011).

Wichtige Strategien zur Überwachung von Klimadaten für die Reduzierung von Botrytis
- Feuchtigkeitskontrolle: Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit: Automatisierte Sensoren können die relative Luftfeuchtigkeit unter 80 % halten, wodurch das Botrytis-Risiko erheblich verringert werden kann (Pineda et al., 2020).
- Dampfdruckdefizit (VPD): Durch die Aufrechterhaltung eines VPD zwischen 0,8 und 1,2 kPa wird die Dauer der Blattnässe reduziert (Reichardt et al., 2019).
- Temperaturkontrolle: Vermeidung optimaler Botrytis-Temperaturen: Durch die Beheizung von Gewächshäusern in der Nacht (1–2 °C über der Außentemperatur) wird die Bildung von Tau verhindert (Elad et al., 2011).
- Optimierung von Luftstrom und Belüftung: Horizontale Luftstromventilatoren (HAF): Verbessern die Luftzirkulation und verhindern die Ansammlung von Sporen (Nicot et al., 2016).
- Automatische Belüftung: Reduziert Feuchtigkeitsspitzen durch den Austausch feuchter Luft (Fernández & Tello, 2011).
- Überwachung der Blattfeuchtigkeit: Elektronische Blattfeuchtigkeitssensoren: Helfen bei der Anpassung des Bewässerungszeitpunkts, um Infektionsfenster zu minimieren (Dik & Wubben, 2004).
- Unterbewässerungssysteme: Reduzieren die Blattnässe im Vergleich zur Überkopfbewässerung (Pineda et al., 2020).
- Datenintegration und Vorhersagemodelle: IoT-basierte Klimaregelung: Automatische Anpassungen reduzieren das Botrytis-Risiko (Reichardt et al., 2019).
- Botrytis-Risikoindex (BRI): Prognostiziert Ausbrüche anhand von Umweltdaten (Holz et al., 2007).
Fallstudie: Umweltkontrolle in der Rosenproduktion
Eine Studie in niederländischen Rosengewächshäusern zeigte, dass die automatisierte Feuchtigkeitskontrolle das Botrytis-Auftreten um 30 % reduzierte (Pineda et al., 2020), und ein weiterer Versuch zeigte eine 20-prozentige Verringerung des Fungizideinsatzes durch Optimierung.
Die Rolle des VPD (Dampfdruckdefizit)
Was ist VPD? VPD ist die Differenz zwischen der Feuchtigkeitsmenge in der Luft und der Feuchtigkeitsmenge, die die Luft bei Sättigung aufnehmen kann. Es ist ein wichtigerer Maßstab für die relative Luftfeuchtigkeit (RH) für die Pflanzengesundheit, da es auch die Temperatur berücksichtigt.
- Niedriger VPD (< 0,5 kPa): Die Luft ist nahezu gesättigt (hohe RH). Die Wasserverdunstung von den Blattoberflächen ist begrenzt. Dadurch entsteht ein Film aus freiem Wasser, der die Hauptvoraussetzung für die Keimung und Infektion von Botrytis-Sporen ist.
- Optimaler VPD (0,8 – 1,2 kPa für viele Kulturen): Es gibt einen optimalen Wert, bei dem die Pflanze effektiv transpirieren kann. Diese Bewegung des Wassers durch die Pflanze hilft beim Transport von Nährstoffen und kühlt sie. Daher bleibt die Blattoberfläche trocken, wodurch die Keimung von Botrytis-Sporen verhindert wird.
- Hoher VPD (> 1,5 kPa): Die Luft ist sehr trocken. Die Pflanze schließt ihre Spaltöffnungen, um einen übermäßigen Wasserverlust zu verhindern, was die Photosynthese effektiv verringert und zu Stress führt.
Wie VPD Botrytis direkt reduziert:
Physikalische Barriere: Die Aufrechterhaltung eines angemessenen VPD sorgt dafür, dass die Blattoberfläche trocken bleibt und eine physikalische Barriere bildet, die das Keimen von Botrytis-Sporen verhindert. Eine Spore kann auf einem Blatt landen, aber ohne flüssiges Wasser bleibt sie inaktiv.
Reduziert freies Wasser: Es verhindert Kondensation auf Pflanzengeweben (Blättern, Blüten, Stängeln) und auf der Innenseite der Gewächshauskonstruktion und beseitigt so die primären Infektionsherde.

Schlussfolgerung
Überwachung der Klimadaten ist für eine nachhaltige Reduzierung von Botrytis in der Blumenzucht unerlässlich. Durch die Einbeziehung von Klimadaten können Züchter Pilzbefall eindämmen und gleichzeitig den Einsatz von Chemikalien reduzieren.
Empfehlungen für Blumenzüchter:
- Umweltsensoren einsetzen (Reichardt et al., 2019).
- Belüftung und Heizung optimieren (Elad et al., 2011).
- Tropfbewässerung zur Minimierung der Blattnässe (Dik & Wubben, 2004).
- Vorhersagemodelle für frühzeitige Interventionen einsetzen (Holz et al., 2007).
Referenzen
- Dean, R., et al. (2012). „The Top 10 fungal pathogens in molecular plant pathology.“ Molecular Plant Pathology, 13(4), 414-430. DOI: 10.1111/j.1364-3703.2011.00783.x
- Dik, A. J., & Wubben, J. P. (2004). „Epidemiology of Botrytis cinerea in greenhouses.“ In Botrytis: Biology, Pathology and Control (pp. 319-333). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4020-2626-3_18
- Elad, Y., et al. (2011). „Climate change impacts on plant pathogens and plant diseases.“ Journal of Crop Improvement, 25(1), 1-29. doi.org/10.3389/fpls.2022.1032820
- Fernández, J. A., & Tello, J. C. (2011). „Environmental control of Botrytis in greenhouse crops.“ Acta Horticulturae, 893, 87-94. DOI: 10.17660/ActaHortic.2011.893.6
- Holz, G., et al. (2007). „Development of a weather-based predictive model for Botrytis cinerea infection.“ Plant Disease, 91(5), 504-512. DOI: 10.1094/PDIS-91-5-0504
- Nicot, P. C., et al. (2016). „Management of Botrytis in greenhouse vegetables.“ Agronomy for Sustainable Development, 36(1), 1-20. DOI: 10.1007/s13593-015-0341-y
- Pineda, A., et al. (2020). „Smart greenhouse climate control reduces Botrytis in roses.“ Biosystems Engineering, 193, 1-10. DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2020.01.016
- Reichardt, M., et al. (2019). „IoT-based climate control for disease prevention in floriculture.“ Computers and Electronics in Agriculture, 162, 882-891. DOI: 10.1016/j.compag.2019.05.034
- Williamson, B., et al. (2007). „Botrytis cinerea: the cause of grey mould disease.“ Molecular Plant Pathology, 8(5), 561-580. DOI: 10.1111/j.1364-3703.2007.00417.x